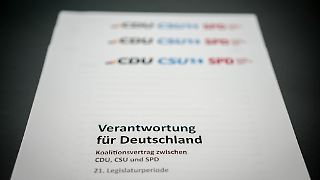Eigentlich sollten die Funde in Großbritannien niemanden mehr überraschen. Schon vor Monaten hatten Schiffe der Royal Navy mutmaßliche russische Spionageboote unweit der britischen Territorialgewässer beschattet. Am Ende war es dann aber doch ein Schock. Wie die „Sunday Times“ vor ein paar Tagen berichtete, hat die britische Marine in den Gewässern rund um die Britischen Inseln Unterwassersensoren gefunden. Einige wurden an Land geschwemmt, andere auf dem Meeresgrund gefunden. Wo genau die Funde erfolgten, schrieb die Zeitung aus Sicherheitsgründen nicht.
„Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass im Atlantik ein Krieg tobt“, sagte ein hochrangiger britischer Militärvertreter der „Sunday Times“. „Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das seit dem Ende des Kalten Krieges andauert und sich jetzt wieder aufheizt. Wir sehen ein unglaubliches Ausmaß an russischen Aktivitäten.“
Die mutmaßlich russische Technik wurde wohl dafür eingesetzt, die vier mit Atomraketen ausgestatteten U-Boote zu überwachen, also Großbritanniens Zweitschlagkapazität und Teil der Abschreckung gegen Russland. Laut einer Studie der Universität Leiden passt das ins Bild.
Seit der Großinvasion der Ukraine hat Russland seine Operationen in Europa verstärkt. Längst geht es nicht mehr nur um Spionage, sondern darum, unmittelbar Schaden zuzufügen. Vor allem Sabotageoperationen haben im Jahr 2024 zugenommen, auch ihr räumlicher Fokus verschiebt sich zunehmend von Osteuropa und dem Baltikum westwärts – nach Deutschland und Frankreich.
Spionage
Klassische Spionage, also das Auskundschaften und Sammeln von teils geheimen Informationen im Auftrag Russlands, bleibt ein großes Problem. Der wohl spektakulärste Fall in Deutschland liegt fast anderthalb Jahrzehnte zurück. 2011 wurden „Heidrun“ und „Andreas Anschlag“ festgenommen, zwei russische Agenten, die sich als in Lateinamerika aufgewachsene Österreicher ausgaben und jahrzehntelang für Russland spionierten.
Solche „Illegals“, die unter mühevoll aufgebauter falscher Identität in Europa leben, setzt Russland bis heute ein. Sie werden seit der Großinvasion vermehrt enttarnt – etwa in den Niederlanden, Norwegen, Griechenland und Slowenien.
Russland setzt aber nicht nur auf „Illegals“, sondern auch auf Verräter aus westlichen Ländern. Seit April 2022 wurden allein in Deutschland drei Fälle publik. Der Bundeswehr-Oberleutnant der Reserve Ralph G. soll für den russischen Militärgeheimdienst GRU spioniert haben. Auch Thomas H., Hauptmann im Bundesamt für Ausrüstung soll für Russland im Einsatz gewesen sein – genau wie Carsten L., Oberst der technischen Aufklärung beim Bundesnachrichtendienst.
Neben Verrätern setzt Russland zunehmend auf „gekaufte Agenten“, häufig Kriminelle ohne geheimdienstliche Ausbildung, die günstig und schnell Aufgaben für die Geheimdienste erledigen sollen.
Der wohl größte Fall in Europa flog 2023 in Großbritannien auf. Dort waren drei Bulgaren im Auftrag der russischen Geheimdienste aktiv, offenbar geführt vom nach Russland geflüchteten Wirecard-Manager Jan Marsalek. Ziele waren US-Militärbasen, russische und kasachische Exilanten sowie die Investigativjournalisten Christo Grozev (Bellingcat) und Roman Dobrokhotov (The Insider). Ähnliche Fälle hatte es zuletzt auch in Lettland und Polen gegeben. Dort ging es um das Auskundschaften von Militärbasen und kritischer Infrastruktur.
Sabotage
Russische Geheimdienste belassen es längst nicht nur bei Spionage. Im vergangenen Jahr wurden in Bayern zwei Deutschrussen wegen Planungen der Sabotage festgenommen. Vor wenigen Monaten wurden sie unter anderem wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit von der Bundesanwaltschaft angeklagt.
Im Juli 2024 gingen in Leipzig, bei Warschau sowie in Birmingham Pakete in DHL-Frachtzentren in Flammen auf. Speziell präparierte Geräte und Chemikalien sollten an Bord von Frachtflügen in die USA Brände auslösen, wurden aber vorzeitig gezündet. Laut Vertretern Litauens und Großbritanniens soll der russische Geheimdienst hinter den Anschlagversuchen stecken, in mehreren Ländern gab es Festnahmen.
In der Ostsee häufen sich seit 2022 Fälle von mutmaßlicher Sabotage an Unterseekabeln und Pipelines. Diese lässt sich mit einem geschleppten Schiffsanker einfach bewerkstelligen, richtet aber Schaden in Millionenhöhe an. Eine russische Urheberschaft der aufwendigen Bombenanschläge auf Nord Stream 1 und 2 scheint bisher nicht belegbar zu sein. Dafür häufen sich Hinweise auf ukrainische Beteiligung.
In anderen Fällen, wie bei der Durchtrennung der Stromleitung Estlink 2 zwischen Estland und Finnland durch den Tanker Eagle S, der der russischen „Schattenflotte“ angehört, ist eine russische Beteiligung indes plausibel. Das Schiff und die Crew wurden in Finnland festgesetzt.
Ebenfalls aus dem östlichen Teil der Ostsee werden immer wieder Störungen des Navigationssystems GPS gemeldet, die den Schiffs- und Flugverkehr behindern. Finnland wirft Russland vor, entsprechende Störsender zu betreiben. Eine polnische Studie kam zum Schluss, dass solche Sender auch auf Tankern der russischen „Schattenflotte“ montiert sein könnten.
Geplante und verübte Mordanschläge
Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass russische Geheimdienste die Ermordung Armin Pappergers geplant haben sollen. Der Chef des deutschen Rüstungsherstellers Rheinmetall, der Waffen in die Ukraine liefert und dort Fabriken aufbaut, steht seitdem unter Polizeischutz. Laut Nato war das Mordkomplott gegen Papperger Teil einer russischen Sabotagekampagne in Europa.
Die in Großbritannien festgenommene Gruppe von „gekauften Agenten“ aus Bulgarien bereitete Pläne für die Entführung und Ermordung des Investigativjournalisten Christo Grozev und seines russischen Kollegen Roman Dobrokhotov vor.
Im März 2018 hatte der russische Militärgeheimdienst GRU einen erfolglosen Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julija im englischen Salisbury verübt. Infolge des Anschlags starb eine Britin, die den von russischen Agenten weggeworfenen Behälter mit den Resten des Nervengifts Nowitschok fand. Im August 2019 ermordete ein GRU-Agent im Berliner Tiergarten den Exil-Tschetschenen Selimchan Changoschwili.
Pavel Lokshin ist Russland-Korrespondent. Im Auftrag von WELT berichtet er seit 2017 über Russland, die Ukraine und den postsowjetischen Raum.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke