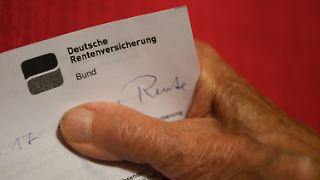Der Bundesrat stimmt der Reform der Schuldenbremse für die Verteidigung und dem Sondervermögen für Infrastruktur zu. Ganz nebenbei räumen Redner der Union ein, warum noch der alte Bundestag entscheiden musste.
Am Ende ist die Zustimmung keine Überraschung: Mit deutlicher Mehrheit hat der Bundesrat der Grundgesetzänderung zugestimmt, die am Dienstag vom Bundestag beschlossen worden war.
Überraschend ist der eine oder andere Ton in der Debatte. Die Länderkammer diskutiert generell viel unaufgeregter als der Bundestag. Es gibt dort keinen Applaus, auch keine Zwischenrufe, weder zustimmende noch höhnische. Selbst der bayerische Ministerpräsident Markus Söder macht sich in seiner Rede nicht - wie sonst häufig - über Bremen, Berlin oder die Grünen lustig, sondern stimmt dem Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD und dem grünen Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, in einzelnen Punkten ausdrücklich zu.
"Historische Zeiten erfordern historische Maßnahmen", sagt der CSU-Chef im Bundesrat. Die Welt sei heute eine andere als vor sechs Wochen. Aber Söder räumt auch ein, dass der Grund für die hastige Grundgesetzänderung die Sperrminorität von AfD und Linken im nächsten Bundestag sei; denn der Beschluss wurde noch vom alten Bundestag in eigens einberufenen Sondersitzungen getroffen. Der im Februar gewählte Bundestag konstituiert sich erst in der kommenden Woche.
Im Bundestag klang das noch ganz anders
Damit stellt sich Söder gegen die offizielle Argumentation der Union. Im Bundestag hatte ihr Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei gesagt, es sei mitnichten so, dass der nächste Bundestag "in drei Tagen bereits handlungsfähig" wäre. Frei verwies auf die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz sowie auf den Eklat im Oval Office, wo US-Präsident Donald Trump zusammen mit Vance den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeführt hatte. Dies mache deutlich, "dass die Herausforderung, uns selbst verteidigen zu können, sehr viel schneller notwendig sein wird, als das in der Vergangenheit von uns gesehen worden ist", so Frei.
Söder räumt diese Linie indirekt ab. Für viele Entscheidungen gebe es im neuen Bundestag keine Mehrheit mehr. "Und darum war die Mitte gezwungen zu handeln und zu entscheiden, ob es eine Grundlage gibt für die Zukunft."
Bei allem Mangel an Häme in seiner Rede und trotz der speziellen Atmosphäre des Bundesrats kann sich Söder einen Seitenhieb dann doch nicht verkneifen - der geht aber nicht nach links, sondern gegen die FDP, die in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt eine Zustimmung ihrer Landesregierungen verhindert hat - wie das BSW in Brandenburg und Thüringen. "Nur extreme Ränder sind dagegen. Und manche Splittergruppe, die nicht mehr im neuen Bundestag sitzt."
"Über Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren"
Anders als der Bayer nimmt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer CDU-Chef Friedrich Merz gegen den Vorwurf in Schutz, vor der Wahl etwas anderes angekündigt zu haben. Ohne Merz namentlich zu nennen, sagt der CDU-Politiker, es habe am Drängen der Bundesländer gelegen, dass es ein Sondervermögen für die Infrastruktur gebe, auch wenn dies vor der Wahl so nicht angekündigt worden sei. "Das haben wir gemeinsam durchgesetzt." Soll heißen: Es war kein Wortbruch der Union, sondern ein Verhandlungserfolg der Bundesländer.
Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein wiederum stützt die offizielle Linie seiner CDU: "Wir leben weltpolitisch in einer komplett anderen Lage." Die "bizarre Rede des US-Vizepräsidenten in München" sowie Selenskyjs "obszöne Demütigung" im Weißen Haus hätten alles verändert, "das hat auch uns verändert". Deshalb seien die massiven Investitionen nötig.
Auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, macht deutlich, dass die Eile gerade mit Blick auf das Sondervermögen seltsam wirken kann: "Seien wir ehrlich: Deutschland wurde über Jahrzehnte teilweise auf Verschleiß gefahren." Viel zu lange sei "nur das Nötigste getan" worden. So könne es nicht weitergehen. Er dürfte wissen, wovon er spricht: Seit Mittwoch ist die A100, eine ohnehin ständig verstopfte Autobahn in der Hauptstadt, wegen einer maroden Brücke gesperrt. Wie Rhein gehört Wegner zu den CDU-Länderchefs, die schon vor der Wahl für eine Reform der Schuldenbremse geworben hatten - damals noch zum Unmut von CDU-Chef Merz.
"Das ist eben nicht vom Himmel gefallen"
Zu dieser Gruppe zählt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Doch nicht er spricht im Bundesrat, sondern seine Stellvertreterin, die grüne Wirtschaftsministerin Mona Neubaur. Sie kritisiert die Eile des Verfahrens ausdrücklich. "Das wussten wir doch schon geraume Zeit, das ist eben nicht vom Himmel gefallen", sagt sie und verweist auf die Begründung der Grundgesetzänderung im Gesetzestext. Selbst dort werde ausgeführt, dass sich die deutsche Wirtschaft "seit inzwischen zwei Jahren in einer Stagnation" befindet, "was vor allem strukturelle Ursachen hat". "Genau das haben wir hier immer wieder vorgetragen." Sie meint nicht ihre Partei, sondern ihr Bundesland.
Insgesamt sprechen elf Ländervertreter. Damit ist die Rednerliste für Bundesratsverhältnisse ungewöhnlich lang. Nur Thüringen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Schleswig-Holstein haben in dieser Debatte keinen Redebedarf.
So gut wie alle Redner betonen, dass sie Bauchschmerzen mit der Neuverschuldung haben, es nun aber nicht anders gehe. Am deutlichsten macht dies der Grüne aus Stuttgart. "Ich stehe hier als Verfechter der Schuldenbremse", sagt Kretschmann. "Es ist nun einmal eine Tatsache, dass die Politik immer wieder in Versuchung kommt, über ihre Verhältnisse zu leben." Aber die Politik habe sich in den letzten Jahren "radikal, in den letzten Monaten und Wochen noch einmal dramatisch" gewandelt. Nötig seien Investitionen in die Verteidigung und in die Infrastruktur. "Wenn wir nicht selbst für unsere Sicherheit und unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sorgen, dann wird es keiner tun."
Wie mehrere andere Ministerpräsidenten nach ihm mahnt Kretschmann eindringlich "eine grundlegende Staatsreform" an. "Wir brauchen die besprochene Staatsmodernisierung", sagt auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
Söder sorgt für einen Lacher
Die meisten Redner schließen ihre Beiträge mit dem Hinweis auf ihr späteres Abstimmungsverhalten. Söder macht dies betont beiläufig. "Bayern stimmt natürlich zu. Das war von Anfang an klar." Da geht ein kurzes Lachen durch den Raum. Denn klar war das keineswegs: Söders Stellvertreter Hubert Aiwanger hatte in der vergangenen Woche angekündigt, seine Partei, die Freien Wähler, könnten der Grundgesetzänderung nicht zustimmen. Normalerweise heißt das für eine Landesregierung: Enthaltung im Bundesrat.
In dieser Woche dann der Kurswechsel. Zur Begründung sagte Aiwanger am Donnerstag bei RTL Direkt, wenn er sich quergestellt hätte, "stünde ich jetzt nicht als stellvertretender Ministerpräsident und Minister hier, sondern wäre schon heute entlassen und am Freitag würde ohne mich die Hand gehoben". Er wäre dann "ein toter Held", denn er wäre "rausgeflogen und es wäre trotzdem durchgegangen ohne uns".
Ganz so stimmt das nicht, denn zwei Länder mit Beteiligung der Linken stimmen ebenfalls zu: Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Sie sowie Bayern geben Protokollerklärungen ab, in denen jeweils dem Unmut des kleineren Koalitionspartners Ausdruck verliehen wird. Es ist Gesichtswahrung, aber wohl auch die Aussicht, ebenfalls von den Milliarden zu profitieren: Von den 500 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz gehen 100 Milliarden an die Länder. Und sie dürfen künftig, ähnlich wie der Bund, Schulden in Höhe von 0,35 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts aufnehmen, was ihnen vorher nicht erlaubt war.
Am Ende gibt es vier Enthaltungen, die im Bundesrat wie Nein-Stimmen gezählt werden: Brandenburg und Thüringen sowie Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Zusammen kommen sie auf 16 Stimmen, denn all diese Länder haben ihrer Größe entsprechend jeweils nur vier Stimmen im Bundesrat. Insgesamt habe es damit 53 Ja-Stimmen gegeben, bilanziert Bundesratspräsidentin Rehlinger das Ergebnis. Es sind sieben Stimmen mehr als nötig.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke